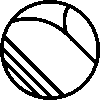Warum ich mich in letzter Zeit über meine berstend volle Cloud aufregte – und wie ich der Bilderlawine zu entkommen versuche.
In meiner Kindheit sah ein gemütlicher Fotoabend bei uns meist so aus: Meine Mutter holte den grossen Plastiksack mit den alten Schwarz-weiss-Bildern vom Dachboden. Wir machten Tee in Omas geblümter Porzellankanne, versammelten uns mit Decken und Kissen auf dem Sofa. Dann wurden reihum so viele Bilder, wie man mit einer Hand zu fassen bekam, aus dem Sack gefischt und herumgereicht. Lauter kleine Zeitkapseln: Opas erstes Fahrrad. Papa mit der Gitarre am Lagerfeuer. Wer findet Mama auf dem Klassenfoto? Oma mit all ihren Geschwistern am Heuwagen. Geheimnisvolle, ernste Gesichter auf zartem, vergilbten Fotopapier. Jede dieser Fotografien schien so wertvoll, zerbrechlich, fast beseelt. An diesen Abenden wurden die schönsten Geschichten erzählt, Erinnerungen wiederbelebt.
«Mich schmerzt der Gedanke, dass viele tolle Bilder in den Clouds vor sich hingammeln.»
Dagegen laufen moderne Fotoabende mit der Familie üblicherweise ja eher so ab: «Wollen wir uns mal die Fotos von deinem letzten Geburtstag ansehen?» Und wir scrollen uns durch Abertausende von Handyfotos, bis die Augen flimmern und der Daumen wund ist. Es ist doch so: Seit uns 36er-Filmrollen nicht mehr einschränken und spätestens seit jeder von uns ein Smartphone mit sich herumträgt, werden gefühlt ganze Kindheiten digitalisiert. Klar, das Bild ist schnell gemacht und virtuelle Wolken bieten nahezu unbegrenzten Speicherplatz. Der Wunsch, alles festhalten zu wollen, ist auch verständlich, denn «sie werden ja so schnell gross». Allerdings horten wir doch um ein Vielfaches mehr an Bildern, als wir uns vermutlich je wieder anschauen werden. Und bei unseren einundzwanzigtausendachthundertunddreissig Fotos in der Cloud frage ich mich: Wann sind gemütliche Fotoabende zu digitalen Endlosschleifen geworden?
Digitale Bilderflut statt Erinnerungen?
Beim ersten Kind kamen wir noch ganz gut hinterher: druckten aus, rahmten ein, legten Fotoalben an. Mit jedem weiteren Kind fielen die guten Vorsätze aber hinten weg, die Bilderlawine rollte weiter. Für die Menge an Bildern, die wir bisher digital produziert haben, bräuchten wir nicht einen bescheidenen Plastiksack, sondern gefühlt einen ganzen Lagerraum. Ich bekomme angesichts dieser Massen jedenfalls regelmässig ein schlechtes Gewissen, dem Ganzen nicht mehr gerecht zu werden. Mich schmerzt der Gedanke, dass viele tolle Bilder in den Clouds vor sich hingammeln. Es stresst mich, dass ich es immer vor mir herschiebe, wenigstens ein paar davon auszudrucken. Und dass sie eines Tages weg sein könnten, einfach so.
«Werden unsere Kinder später noch unterscheiden können zwischen Foto und Erinnerung?»
Denke ich dagegen an die Bilder aus meiner eigenen Kindheit, passen diese locker in einen Schuhkarton. In meinem Kopf sind dafür unzählige Erinnerungsfetzen abgespeichert. Darunter Momente, die ich mir als Kind ganz bewusst ins Gehirn einbrannte. Ich nenne sie meine «Hirnfotos», für immer gesichert, jederzeit abrufbar. Manchmal denke ich: Wie werden die Erinnerungen unserer Kinder einmal aussehen? Werden sie später noch unterscheiden können zwischen Foto und Erinnerung? Was macht das mit ihrem Selbstbild? Und überhaupt: Was sollen sie einmal mit den ganzen Bildern von sich anfangen?
Den eigenen Augen trauen
Ich will die Handyfotografie nicht verteufeln, und nostalgisch bin ich nur selten. Aber alles in allem hatten die Zeiten, in denen auf einen Film 36 Bilder passten, doch ihr Gutes. Wir lebten langsamer und bewusster als im heutigen digitalen Dauerrausch.
«Dadurch, dass wir den Moment unbedingt festhalten wollen, riskieren wir, ihn zu verpassen.»
Was unsere Bilderflut angeht, habe ich mir erst einmal vorgenommen, achtsamer und weniger zu fotografieren. Das klappt erstaunlich gut. Mittlerweile verspüre ich auch gar keinen Drang mehr, in einem besonderen Moment sofort nach dem Smartphone zu greifen. Denn das Paradoxe am schnellen Handyfoto ist ja auch: Dadurch, dass wir den Moment unbedingt festhalten wollen, riskieren wir, ihn zu verpassen. Vielleicht sollten wir uns generell wieder mehr auf unsere Augen verlassen. Schliesslich sind die kleinen grauen Zellen dahinter auch eine verdammt gute Speicherplattform.
Dieser Beitrag erschien zuerst im Tagesanzeiger Mamablog.